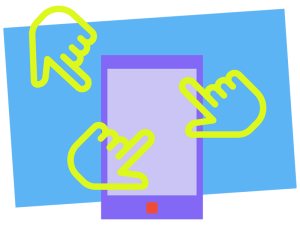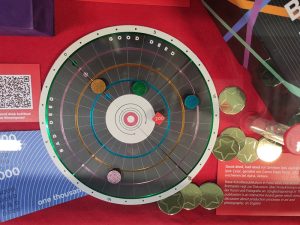Im Juni 2024 lud die Staatsbibliothek zu Berlin gemeinsam mit der Bibliothek der Universität der Künste Berlin und NFDI4Culture – dem Konsortium für materielle und immaterielle Kultur der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur – zu einem ganztägigen Barcamp unter dem Titel „Die Bibliothek als Objekt & die Objekte der Bibliothek“ ein. Angesprochen waren Kunstschaffende, Angehörige von Kunsthochschulen, Museen und Bibliotheken sowie alle, die sich für die Verbindung von Kunst und Bibliothek interessieren.
Im Mittelpunkt standen Themen wie Kuratieren, Kanonisieren, Sammeln oder Vermitteln – jedoch in einem Format, das sich bewusst vom klassischen Konferenzstil abhebt. Statt eines festen Programms oder vorab eingeladener Vortragender lebt ein Barcamp von Interaktion, Austausch und Mitgestaltung. Die Teilnehmenden entwickeln die Agenda spontan vor Ort, schlagen selbst Themen vor und gestalten parallel stattfindende Sessions, die ganz auf ihre Interessen abgestimmt sind. Nach kurzen Impulsvorträgen zu den ausgewählten Themen geht es direkt in den aktiven Austausch – sei es in kleinen Gruppen oder über mehrere Sessions hinweg.
In diesem Interview berichtet uns Maria Safenreiter von Ihrem Erlebnis:
Lydia Koglin (LK):
Hallo Maria, wir haben uns im Sommer 2024 beim Barcamp in der Stabi kennengelernt. Was hat Dich damals dazu bewegt, am Barcamp „Die Bibliothek als Objekt & die Objekte der Bibliothek“ teilzunehmen?
Maria Safenreiter (MS):
Hallo Lydia. Meine Teilnahme am Barcamp war im Grunde gleich doppelt motiviert: Zum einen befand ich mich zum Veranstaltungszeitpunkt am Ende der Bearbeitung meiner Masterarbeit zum Thema Kunstpraxis im Bibliotheksraum, die ich im Rahmen meines Bibliotheksreferendariats schrieb; zum anderen begleitet mich das Interesse an Vermittlung sowie Ermöglichungsräumen von Kunst sozusagen auf meinem gesamten Bildungsweg, da ich ursprünglich Kunsterziehung an der Bauhaus-Universität Weimar studiert habe.
LK: Ein Barcamp ist ja eine sogenannte „Un-Konferenz“ ohne vorher feststehendes Programm. Wie hast du dieses Format erlebt? Bist du mit einem eigenen Thema im Gepäck angereist? Wenn ja, worum ging es?
MS: Die Idee, das – bildlich gemeinte – Negativ einer Konferenz als Workshop produktiv zu machen, etwa die Vortragspausen, in denen sich erst die Möglichkeit bietet, diejenigen Personen anzusprechen, mit denen man sich wegen ähnlicher Vorhaben, Visionen oder Themen schon immer vernetzen wollte – diese Idee leuchtete mir sofort ein. In ihrer Umsetzung durch das von euch mitorganisierte Barcamp hat mich vor allem positiv überrascht, dass dadurch eine Art Safe Space entstand, in den man auch unfertige Gedanken und Ansätze oder offene Fragen hineingeben konnte. Dazu zählen beispielsweise die Frage nach der Bedeutung von Artistic Research für Bibliotheksraum und -infrastruktur oder die grundsätzliche Frage nach Gestaltung von Kunsträumen innerhalb von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken.
LK: Siehst Du Potenzial für weitere Projekte oder Kooperationen zwischen Kunst und Bibliotheken?
MS: Bibliotheken und Kunst(schaffende) haben viel Grundsätzliches gemeinsam, etwa die Tendenz weg von einem statischen hin zu einem dynamischen Begriff der durch sie konstituierten Wahrnehmungs- und Arbeitsräume. Allein diese Gemeinsamkeit bietet meiner Einsicht viel Potential für Projekte rund um das Thema dynamisches Publizieren in der Art Practice oder die Ordnung und Erschließung des gegenseitigen Wissens.
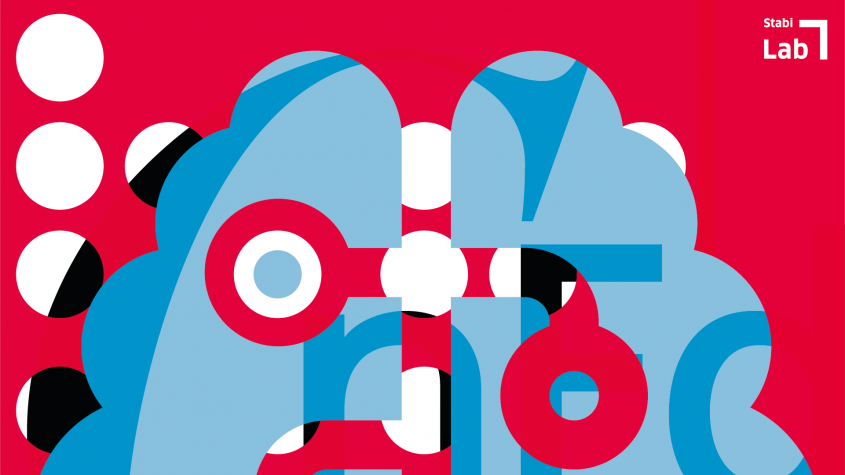
© Staatsbibliothek zu Berlin
Lydia Koglin ist Fachreferentin an der UB der UdK für Kunst und Architektur und hat ihre Masterarbeit über Künstlerbücher in der Bibliothek geschrieben.
Maria Safenreiter hat in romanistischer Literaturwissenschaft promoviert und anschließend ihr Bibliotheksreferendariat gemacht, das sie mit einer Masterarbeit zum Thema Kunstpraxis und Bibliotheksraum abgeschlossen hat. Zurzeit arbeitet sie als Fachreferentin an der ULB Halle.
© Christina Giakoumelou
Lydia Koglin
© Angabe fehlt
Maria Safenreiter